Der Anti-Vater

Auszüge aus Sarane Alexandrians Buch André Breton par lui-même, Éditions du Seuil, Paris 1971
Übersetzung: Heribert Becker, in: André Breton: Bindestrich. Texte 1952–1965, Rimbaud Verlag, Aachen 2008
 enn man über André Breton spricht, hat man vor allem den Begründer des Surrealismus vor Augen, den Mann, der einer Gemeinschaft von Dichtern und bildenden Künstlern seine Forderungen nach Strenge nahegebracht hat. So berechtigt eine solche Sichtweise auch ist, sie läuft Gefahr, zu Fehleinschätzungen seiner Person und seines Werks zu führen; wer sie vertritt, setzt den Surrealismus mit einer literarischen Schule gleich, obwohl er doch eine mit der Überzeugung einer revolutionären politischen Partei ins Leben gerufene poetische Partei war, und macht Breton zum bloßen Initiator einer Avantgardebewegung, während er in Wirklichkeit einen Typus von Schriftsteller verkörpert, wie ihn aufmüpfige junge Intellektuelle suchen, aber nur selten finden: den Anti-Vater. Dieser Begriff ist höchst modern und geht allenfalls bis auf die Romantik zurück. Gewöhnlich meint man, das Meister-Schüler-Verhältnis setze die Abhängigkeit von einem geistigen Vater voraus. Manche Menschen haben jedoch das Bedürfnis, über diese bequeme Situation hinauszukommen, und wählen sich als Leitfigur einen Anti-Vater, das heißt jemanden, der einer Kunst des Lebens den Weg bereitet, die derjenigen des Vaters entgegengesetzt ist, welcher als Inbild der im Namen der herrschenden Ordnung verhängten Verbote und Strafen angesehen wird. Ist der Vater derjenige, der Pflichten auferlegt, so ist der Anti-Vater derjenige, der Rechte fordert. André Gide war in der Zeit der Verliese des Vatikans der Anti-Vater einer ganzen Generation; Breton ist derjenige der darauffolgenden Generation gewesen und hat diese Rolle auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt, diesmal in Konkurrenz zu einem anderen, ganz anders gearteten Anti-Vater: Jean-Paul Sartre.
enn man über André Breton spricht, hat man vor allem den Begründer des Surrealismus vor Augen, den Mann, der einer Gemeinschaft von Dichtern und bildenden Künstlern seine Forderungen nach Strenge nahegebracht hat. So berechtigt eine solche Sichtweise auch ist, sie läuft Gefahr, zu Fehleinschätzungen seiner Person und seines Werks zu führen; wer sie vertritt, setzt den Surrealismus mit einer literarischen Schule gleich, obwohl er doch eine mit der Überzeugung einer revolutionären politischen Partei ins Leben gerufene poetische Partei war, und macht Breton zum bloßen Initiator einer Avantgardebewegung, während er in Wirklichkeit einen Typus von Schriftsteller verkörpert, wie ihn aufmüpfige junge Intellektuelle suchen, aber nur selten finden: den Anti-Vater. Dieser Begriff ist höchst modern und geht allenfalls bis auf die Romantik zurück. Gewöhnlich meint man, das Meister-Schüler-Verhältnis setze die Abhängigkeit von einem geistigen Vater voraus. Manche Menschen haben jedoch das Bedürfnis, über diese bequeme Situation hinauszukommen, und wählen sich als Leitfigur einen Anti-Vater, das heißt jemanden, der einer Kunst des Lebens den Weg bereitet, die derjenigen des Vaters entgegengesetzt ist, welcher als Inbild der im Namen der herrschenden Ordnung verhängten Verbote und Strafen angesehen wird. Ist der Vater derjenige, der Pflichten auferlegt, so ist der Anti-Vater derjenige, der Rechte fordert. André Gide war in der Zeit der Verliese des Vatikans der Anti-Vater einer ganzen Generation; Breton ist derjenige der darauffolgenden Generation gewesen und hat diese Rolle auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt, diesmal in Konkurrenz zu einem anderen, ganz anders gearteten Anti-Vater: Jean-Paul Sartre.
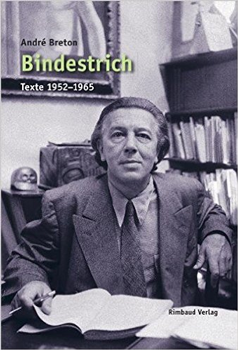 Um eine solche Stellung einzunehmen, braucht ein Schriftsteller die grenzenlose Liebe zur blühenden Freiheit. Im übrigen hat Breton stets voller Leidenschaft seinen Glauben an den Genius der Jugend zum Ausdruck gebracht, wobei er die jungen Menschen beschwor, sich von den Älteren nicht ihres Rechts auf Revolte und Enthusiasmus berauben zu lassen, und die Erwachsenen aufforderte, nicht gegen all das zu freveln, was an der Schwelle zum Leben an träumerischem Überschwang in einem Menschen vorhanden ist. Davon kann man sich anhand des Vortrags überzeugen, den er am 10. Dezember 1942 vor den französischen Studenten der Yale-Universität in New Haven/Connecticut gehalten hat: Nie hat sich ein Schriftsteller dieses Ranges weniger schulmeisterlich geäußert. Er erklärt seinen Zuhörern im Namen der Männer seines Alters, er komme sich ihnen gegenüber arm vor und gestehe seiner Generation keinerlei Vorrechte über die ihrige zu: »Nein, weder das höhere Alter noch auch die weissagende Reife berechtigen zu Ansprüchen an Sie: Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Sie sie an die Kandare nehmen, sie zur Ordnung rufen müssen, wenn sie sich anheischig machen, Ihnen ein Licht aufzustecken.« Wenn Breton selbst auch der Sammelpunkt einer Jugend sein wollte, die bestrebt ist, den Konventionen zu entfliehen, so war es doch nicht sein uneingestandener Wunsch, es soweit zu bringen, dass sie in Ehrfurcht vor ihm erstarrte: »Es gibt keine menschlichen Schultern, auf die sich die Allwissenheit laden ließe. Man hat den Menschen nur allzu sehr eingeschärft, auf diese Allwissenheit, die man zu einem Attribut >Gottes< hat machen wollen, in dem Maße Anspruch zu erheben, wie er sich als sein >Ebenbild< verstand. Mit diesen beiden Albernheiten muss gleichzeitig Schluss gemacht werden. Nichts von dem, was der Mensch festgesetzt oder verfügt hat, darf als endgültig und unantastbar angesehen werden und erst recht nicht Gegenstand eines Kults sein, fordert dieser doch Verzicht und Entsagung zugunsten eines vorausgehenden vergöttlichten Willens.«
Um eine solche Stellung einzunehmen, braucht ein Schriftsteller die grenzenlose Liebe zur blühenden Freiheit. Im übrigen hat Breton stets voller Leidenschaft seinen Glauben an den Genius der Jugend zum Ausdruck gebracht, wobei er die jungen Menschen beschwor, sich von den Älteren nicht ihres Rechts auf Revolte und Enthusiasmus berauben zu lassen, und die Erwachsenen aufforderte, nicht gegen all das zu freveln, was an der Schwelle zum Leben an träumerischem Überschwang in einem Menschen vorhanden ist. Davon kann man sich anhand des Vortrags überzeugen, den er am 10. Dezember 1942 vor den französischen Studenten der Yale-Universität in New Haven/Connecticut gehalten hat: Nie hat sich ein Schriftsteller dieses Ranges weniger schulmeisterlich geäußert. Er erklärt seinen Zuhörern im Namen der Männer seines Alters, er komme sich ihnen gegenüber arm vor und gestehe seiner Generation keinerlei Vorrechte über die ihrige zu: »Nein, weder das höhere Alter noch auch die weissagende Reife berechtigen zu Ansprüchen an Sie: Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Sie sie an die Kandare nehmen, sie zur Ordnung rufen müssen, wenn sie sich anheischig machen, Ihnen ein Licht aufzustecken.« Wenn Breton selbst auch der Sammelpunkt einer Jugend sein wollte, die bestrebt ist, den Konventionen zu entfliehen, so war es doch nicht sein uneingestandener Wunsch, es soweit zu bringen, dass sie in Ehrfurcht vor ihm erstarrte: »Es gibt keine menschlichen Schultern, auf die sich die Allwissenheit laden ließe. Man hat den Menschen nur allzu sehr eingeschärft, auf diese Allwissenheit, die man zu einem Attribut >Gottes< hat machen wollen, in dem Maße Anspruch zu erheben, wie er sich als sein >Ebenbild< verstand. Mit diesen beiden Albernheiten muss gleichzeitig Schluss gemacht werden. Nichts von dem, was der Mensch festgesetzt oder verfügt hat, darf als endgültig und unantastbar angesehen werden und erst recht nicht Gegenstand eines Kults sein, fordert dieser doch Verzicht und Entsagung zugunsten eines vorausgehenden vergöttlichten Willens.«
Ein paar Bemerkungen genügen, um deutlich zu machen, worin sich André Bretons Botschaft an die Jugend von derjenigen der »Väter« in der zeitgenössischen Literatur unterscheidet. In den konformistisch-frommen Reden, mit denen man den jungen Leuten den Kopf zurechtzurücken pflegt, wird in erster Linie immer wieder die Arbeit verherrlicht. Der moralische Wert der Arbeit: auch den hat Breton entschieden negiert. Wie Rimbaud davon überzeugt, dass »die Hand an der Feder soviel wert ist wie die Hand am Pflug«, hat er diejenigen besonders gemocht, die nicht »zur Hand« sind. »Ich muss den Gedanken der Arbeit als materielle Notwendigkeit akzeptieren; was das angeht, so bin ich unbedingt für ihre beste, ihre gerechteste Verteilung. dass die schändlichen Zwänge des Lebens sie mir aufbürden, muss ich hinnehmen; aber dass man von mir verlangt, an sie zu glauben und für die meinige oder die der anderen Ehrfurcht zu empfinden: niemals. Auch hier laufe ich lieber durch die Dunkelheit, als zu glauben, ich sei derjenige, der durchs Helle geht. Es ist nutzlos, am Leben zu sein, solange man arbeitet.«
Ferner versucht man, junge Menschen von der Allmacht der Wissenschaft zu überzeugen. Jedes Mal, wenn eine technische Erfindung gemacht wird, sieht man die Medien der optimistischen Wahnvorstellung verfallen, diese Erfindung werde die heiklen menschlichen Probleme endgültig lösen. Breton hat sich immer nachdrücklich gegen diese idiotisierende Auffassung von Glück gewandt. Im Manifest des Surrealismus spottet er über die breite Masse, die sich einbildet, einziges Ziel der Wissenschaft sei es, ihr Los auf Erden zu verbessern. »Ich weiß nicht, was genau an humanitären Absichten in das Ideal der Gelehrten Eingang findet, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es ein allzu großes Maß an Güte ist.« In einem Interview, das er im Mai 1935 Indice, einer sozialistischen Zeitschrift auf Teneriffa, gab, warnte Breton die progressistischen Organisationen vor der Gefahr: »Hüten wir uns, zur Entstehung einer neuen Religion beizutragen, die paradoxerweise eine Religion der Wissenschaft wäre.«
Tatsache ist, dass Breton als großer Meister des Spiels – als Gegenbegriff zur Arbeit verstanden – in Erscheinung getreten ist. Nicht ohne ethische Begründung frönte er mit seinen Freunden immer wieder neuen Spielen: dem Wahrheitsspiel, dem Spiel des Erlesenen Leichnams, dem Spiel des »Was wäre, wenn...«, dem Spiel des analogischen Porträts, dem Spiel »Das eine im anderen« usw. Spielen können hieß für ihn zeigen, dass man sich sein kindliches Gemüt bewahrt hat, dass man jederzeit im Sinne der natürlichen Freuden des Lebens zu handeln vermag. Breton regte zur Erhellung der Welt durch den objektiven Humor an, dessen höchste Form, den schwarzen Humor – der Begriff stammt von ihm –, er als die einzige Kraft definiert hat, die das Bedürfnis zu spielen und das Bedürfnis zu handeln miteinander zu versöhnen vermag: Der schwarze Humor, der »der Todfeind schlechthin der Gefühlsduselei, die so wirkt, als sei sie ständig in größter Bedrängnis – der Gefühlsduselei auf immer blauem Grund –, und einer bestimmten kurzatmigen Phantasie ist, die sich allzu oft für Poesie ausgibt«, ist wohl die stärkste Triebfeder der Anti-Vater-Moral, die er entwickelt hat.
Man hat Breton häufig mit einem Löwen verglichen, aber man muss präzisieren, dass er nicht nur wie ein Löwe aussah. Sein Brüllen und sein Tatzenhieb waren überaus gefürchtet. Ich glaube, einer der Gründe für die Faszination, die er auf die Jugend ausübte, war eben dieser unterschwellige, in die ausgesucht höflichen Umgangsformen eines noblen Herrn verpackte Hang zum Gewaltsamen. Ich werde mich immer des Abends erinnern, an dem ich seine Bekanntschaft machte, nämlich bei dem provokanten Vortrag über den Surrealismus, den Tristan Tzara, damals der KP nahestehender Ex-Dadaist und Ex-Surrealist, am 11. April 1947 in der Sorbonne zu halten versuchte. Breton, eskortiert von einigen Getreuen, betrat wie ein großes Raubtier den mit Neugierigen überfüllten Hörsaal, in dem ihn zahlreiche Feinde »Gewehr bei Fuß« erwarteten; als er von allen Seiten her seinen Namen flüstern hörte, hob er den Kopf, formte Daumen und Zeigefinger vor seinem Auge zu einem Ring und musterte das Publikum durch dieses improvisierte Monokel hindurch mit prachtvoller Arroganz. Kaum hatte Tzara zu sprechen begonnen, sprang er ungestüm von seinem Sitz auf, wies anklagend mit dem Zeigefinger auf den Redner und überhäufte ihn mit Schmähungen. Es kam zu einem unbeschreiblichen Durcheinander, und Breton versank buchstäblich in der tobenden Meute der Anhänger Tzaras. Ich war damals ein blutjunger Student, und dieses Schauspiel elektrisierte mich; ich stürzte mit wenigen Sätzen die Stufen des Hör-saals hinab und warf mich in das Gewühl rings um Breton. Tzara, hinter seinem Katheder sitzend, die Augen vor dadaistischer Spottlust funkelnd, beobachtete die Schlacht mit sichtlichem Vergnügen. Im Anschluss an diese denkwürdige Veranstaltung scharte Breton seine Parteigänger im Souterrain des »Dupont« um sich. Eine junge griechische Studentin, Freundin des surrealistischen griechischen Dichters Andreas Embiríkos, überreichte ihm eine Rose; er küsste ihr, wie er das bei Frauen oft tat, die Hand, worauf das Mädchen genauso rot wurde wie die Rose. Ich war hingerissen von der durch ein jünglingshaftes Ungestüm gemilderten Souveränität dieses Einundfünfzigjährigen und hatte das Gefühl, einem der intellektuellen Heroen unserer Zeit gegenüberzustehen, einem von denen, wie es sie in jedem Jahrhundert nur vier- oder fünfmal gibt.
Es sind zwei verschiedene Dinge, Breton nur gelegentlich, vor allem in seinen letzten Lebensjahren, begegnet zu sein und ihn als Zwanzigjähriger zum Lehrmeister gehabt zu haben – wie dies bei mir der Fall war –, als er sich in der vollen Kraft seiner Reifezeit befand. In den privaten Gesprächen mit ihm – sei es, dass er von den Vaudou-Zeremonien erzählte, die er in Haiti miterlebt hatte, sei es, dass er einem ein Gedicht von Hugo oder Nerval vorlas, um einen bestimmten Gesichtspunkt der romantischen Poesie zu erhellen, sei es, dass er ein Spiel organisierte, sei es, dass er einen zu einem Vortrag seines feindlichen Bruders Georges Bataille mitnahm, sei es, dass er einen in seiner Begleitung über die Uferwege entlang der Seine flanieren ließ, um »das Schimmern des Feuersteins« zu bewundern, sei es, dass er über die Vorbereitungen zu einer Ausstellung oder zu einem Flugblatt diskutierte – wurde man in ein fortwährendes Abenteuer des Erkennens hineingezogen. Mit einem solchen Lehrmeister fühlte man sich gegen jede Art von Konformismus für immer gefeit. Bei diesem einflußreichen Schriftsteller, der so olympisch zu sein schien, gab es keine Spur von Pose. Hatte er nicht geschrieben: »Welch einer Selbstgefälligkeit es doch bedarf, um auf intellektuellem Gebiet von sich zu meinen, man habe etwas geleistet! Die großen Philosophen, die großen Dichter, die großen Revolutionäre, die großen Liebenden: ich weiß. Aber wie soll man, wenn man nicht sicher ist, je diese Größe zu erreichen, es anstellen, lediglich ein Mensch zu sein? Wie soll man den Platz rechtfertigen, den man beim Essen, beim Trinken, beim Sichkleiden, beim Schlafen einnimmt?« Ein Mensch zu sein, in der ganzen Reinheit des Möglichen, nicht als ein von gesellschaftlichen Vorurteilen und beruflicher Routine mechanisiertes Wesen, war das oberste Gebot, das Breton Menschen in seiner näheren Umgebung näherzubringen suchte. An seiner Seite lernte man das savoir-vivre der Dichter, dessen wichtigster Bestandteil ein savoir-aimer ist: die Kunst zu lieben. Breton brauchte die Dinge nicht zu erklären, um sie einem begreiflich zu machen. Es genügte, dass er zeigte, wie er sie verabscheute oder wie er sie liebte, je nachdem. Das Beispiel war ansteckend.
Man bewunderte ihn wegen seines würdevollen Verhaltens als Schriftsteller, der trotz der bescheidenen Einkünfte, über die er verfügte, weder an Preise noch an Auszeichnungen noch an Akademien dachte. 1950 lehnte er, ohne viel Aufhebens davon zu machen, den Prix de la Ville de Paris, der ihm angetragen wurde (und der dann an Jules Supervielle ging) ab und antwortete einem Journalisten, der sich darüber wunderte: »Das kostbarste Gut, dasjenigen, dessen Verlust sich durch nichts aufwiegen lässt, ist die Unabhängigkeit.« Man bewunderte ihn auch wegen seiner nicht nachlassenden Offenheit für alles, was sich im Bereich des künstlerischen Ausdrucks an Neuem ereignete. Immer wieder ist er auf junge Dichter zugegangen, etwa als er sich für Henri Pichette interessierte, in dessen Epiphanies eine Zeitlang ganz Paris lief (und Pichettes Lettre orangée an Breton ist ein merkwürdiges Zeugnis für die Gefühle, die er in einem begabten, höchst ungebärdigen Anfänger hervorrief), als er Yves Bonnefoy zu einer Zeit sein Vertrauen schenkte, da dieser noch nichts weiter war als Redakteur der Zeitschrift La Révolution la nuit, als er einer der ersten Veranstaltungen der Lettristen beiwohnte und Isidor Isou einlud, sich bei einem privaten Treffen in seiner Wohnung näher zu äußern, oder als er das Vorwort zu Jean-Pierre Dupreys schönem Theaterstück Derrière son double schrieb.
Da er nun einmal die Menschen, die geeignet waren, einen lyrischen Umsturz der Werte herbeizuführen, in einer brüderlichen Kampfgemeinschaft um sich scharen wollte, setzte Breton seine Ehre darein, dieser Bruderschaft eine exemplarische Kohärenz zu verleihen. Und doch gab es in seinen Beziehungen zu den Freunden ein beinahe rituelles Phänomen, das von seinen Biographen meistens nicht recht verstanden wird: den Bruch der Freundschaft. Während seines ganzen Lebens erlebt man bei ihm ganz plötzliche Änderungen seiner Meinung über Menschen, die ihm bis dahin lieb und teuer waren. Die meisten großen Surrealisten, abgesehen von ganz wenigen wie Péret und Tanguy, haben sich mindestens einmal mit Breton überworfen, was nicht heißt, dass sie nicht später zu ihm zurückgekehrt sind – oder er zu ihnen. Es wäre zu bequem, das auf monentane (Ver-)Stimmungen oder tyrannische Launen zurückzuführen. Ich darf hier versichern, dass der Bruch mit Breton eine initiatorische Bedeutung besaß und gleichsam der Beweis war, dass man seine Lektion verarbeitet hatte. Nietzsches Zarathustra äußert sich in dieser Richtung, wenn er seinen Schülern rät, ihn zu verlassen, um ihm zu zeigen, dass sie ihn verstanden haben.
Die Kräche im Surrealismus liefen äußerst dramatisch ab; sobald Breton spürte, dass man seinem Einfluss entglitt, suchte er den Bruch, nicht in seinem eigenen Namen, sondern in dem der Gemeinschaft. Das Zerwürfnis mit Aragon war eine besonders schmerzliche Angelegenheit, und es ging dabei seitens des Autors von Anicet nicht ohne heiße Tränen und die Drohung ab, sich das Leben zu nehmen. Éluard hingegen trennte sich von Breton, so wie sich eine reife Frucht von dem Baum löst, der sie getragen hat. Breton setzte ein Tribunal ein, vor dem der Beschuldigte sich zu äußern hatte, wenn er nicht in Abwesenheit verurteilt werden wollte. Er selbst führte bei diesem Gericht mit entschlossener Autorität und erdrückenden Argumenten den Vorsitz. Ich weiß, wovon ich rede, habe ich doch bei einer Versammlung, auf der etwa fünfzig Mitglieder der Pariser Surrealistengruppe aufgefordert waren, zwei Maler auszuschließen, für die ich mich stark machte, lange gegen ihn opponiert; ich war baß erstaunt über die unerbittliche Dialektik, mit der er die eher harmlosen Vergehen, die er den beiden vorzuwerfen hatte, verbissen hochstilisierte. (Zehn Jahre später ließ er ihnen übrigens öffentlich Gerechtigkeit widerfahren.) Da es mir nicht gelang, ihn zu überzeugen, verließ ich die Sitzung, um mein Missfallen zum Ausdruck zu bringen, und mit mir gingen mehrere Freunde; einer von ihnen wäre draußen beinahe ohnmächtig geworden, so nervenaufreibend war das leidenschaftliche Klima der Debatte gewesen. Dergestalt ging es zu, wenn es innerhalb der Surrealistengruppe zu einem Bruch kam. Lange danach rechtfertigte Breton mir gegenüber in einem Brief seine Haltung; ich begriff, dass er seiner Rolle als Anti-Vater durchaus nicht zuwiderzuhandeln glaubte, wenn er solche Vorfälle herbeiführte, sondern vielmehr meinte, er setze sie einer Belastungsprobe aus.
Gegen Ende seines Lebens wurden Bretons öffentliche Stellungnahmen selten und kamen eher aus dem Hintergrund. Wer wissen wollte, was er dachte, musste sich an die Vorworte, die er zu Einzelausstellungen und zu bestimmten Büchern schrieb, und an einige kurze Zeitschriftentexte halten. Unter diesen Vorworten gibt es sehr bemerkenswerte: dasjenige zu einer Neuausgabe von Maturins Melmoth (in dem er meisterhaft die »hohe Fiktion« analysiert), dasjenige zu Panizzas Liebeskonzil (worin er »die Tiefe des Abgrunds: Warum das Böse?« untersucht), dasjenige zu Karel Kupkas die Rindenmalerei der australischen Aborigines behandelndem Buch Un art à l'état brut (Eine Kunst im Rohzustand) (wo er ätzende Kritik an den Ethnologen übt). Seine besten Zeitschriftenbeiträge der letzten Jahre sind »Magie quotidienne« (Alltagsmagie), worin er kleine Beispiele von objektivem Zufall wiedergibt, und »Langue des pierres« (Sprache der Steine), wo von der poetischen Faszination bestimmter Mineralien und Fossilien die Rede ist. Die Zeitschrift La Brèche, die er von 1961 bis 1965 redigiert hat, besaß dank der Neuartigkeit der Probleme, die er darin hat anpacken lassen, ein untadeliges Niveau. Und schließlich war seine allerletzte Unternehmung, die langsame und sorgfältige Vorbereitung der Pariser Surrealismus-Ausstellung von 1965, »L'Écart absolu« (Die absolute Abweichung), zu der er das aus einer einfachen Montage von Zitaten bestehende Katalogvorwort geliefert hat, eine symbolische Tat: Er machte die Veranstaltung zu einer Demonstration gegen die Übel unserer Zivilisation, insbesondere gegen den Militarismus und die Technokratie.
Bretons Begräbnis am 1. Oktober 1966 auf dem Friedhof von Batignolles wohnte eine auf annähernd fünftausend Personen geschätzte Menschenmenge bei, in der man seit langem von ihm getrennte Persönlichkeiten entdeckte – und viele von Neugierde und Unruhe hierher getriebene namenlose junge Pärchen. Als ich einen Jugendlichen sah, der mit Tränen in den Augen an einem Baum lehnte, dachte ich, fortan werde auch auf Breton zutreffen, was er selbst einst über Apollinaire geschrieben hatte: »Ihn gekannt zu haben, wird als seltener Vorzug gelten. Jungen Menschen wird wieder der treuherzige Satz einfallen: Ich bin zu spät gekommen. Diejenigen werden das Bild des Dichters festschreiben, die es mit großer Liebe unversehrt bewahrt haben.« Eine Rede wurde an seinem Grab nicht gehalten – wer von seinen hinterbliebenen Freunden hätte es schon gewagt zu sprechen? –, das nur ein einziger, im Namen der anarchistischen Gruppe Louise Michel niedergelegter Kranz schmückte und in dessen Platte später Bretons frühe Devise »Je cherche l'or du temps« (Ich suche das Gold der Zeit) eingraviert wurde. Der Dichter hat ein Testament mit der strengen Auflage hinterlassen, dass die Veröffentlichung seines umfangreichen Briefwechsels nicht eher gestattet ist, bis vom Tage seines Ablebens an fünfzig Jahre vergangen sind. Nur jenen, die im Jahre 2016 zwanzig Jahre alt sein werden, wird es also möglich sein, vollständig herauszufinden, wer Breton in seinem Privatleben war. Wenn die Welt sich weiterhin auf der bisherigen Bahn bewegt, werden sie es wahrscheinlich nötig haben, auf diese Weise aufgerüttelt zu werden.
Bei einem Gespräch, an dem Breton gemeinsam mit Pierre Reverdy und Francis Ponge (was für ein Zusammentreffen, die Begegnung dieser drei Experten des Wortes!) im Rundfunk teilnahm, erwiderte er auf die Frage nach der gesellschaftlichen Rolle des Dichters: »Der Dichter hat wahrlich eine sehr schöne Zukunft... als Wiedergänger. Ein Wiedergänger, der übrigens nichts Feindseliges mehr hat und der sogar mit allen Zauberreizen geschmückt ist.« Genau diese Illusion bleibt zurück, wenn wir ihn ganz gelesen haben: dass er wiederkommen wird. Noch bis weit in die künftigen Generationen hinein wird sein Name auf jungen Lippen, die die Sprache der Verzauberungen zu sprechen suchen, aufs Neue aufleben. Fortan zählt er, zusammen mit Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire und einigen anderen, zu jener Schar prachtvoller Wiedergänger, die im inneren Schloss des Menschen ihr Wesen treiben, um es vor den Unbilden der Zeit zu bewahren.
Sarane Alexandrian / Übersetzung Heribert Becker / forum.psrabel.com
